Deal Sourcing mit AI: Was Sie wissen müssen
Deal Sourcing mit AI: Was Sie wissen müssen
TL;DR KI revolutioniert das Deal Sourcing im Venture Capital und Private Equity, indem sie Prozesse automatisiert und eine umfassende Analyse großer Datenmengen ermöglicht. Traditionelle Methoden wie beziehungs- und reputationsbasiertes Sourcing werden durch KI-Tools ersetzt, die effizientere, datengestützte Entscheidungsfindung bieten. Vorteile sind die Reduktion von Bias, gesteigerte Effizienz sowie Zugang zu umfangreichen Daten. Tools wie Grata, Cyndx und SignalRank helfen dabei, potenzielle Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und die Due Diligence zu automatisieren. Trotz der Herausforderungen, wie Datenqualität und der Undurchsichtigkeit mancher Systeme, wird KI in der Zukunft eine noch zentralere Rolle spielen. Insgesamt ergänzt KI das menschliche Urteil und sollte als wertvolles Werkzeug zur Verbesserung der Effizienz und Entscheidungsfindung im Deal Sourcing betrachtet werden.
Nicht zuletzt durch den explosivartigen Anstieg an Startups und dazugehörigen Startup-Aktivitäten wird es immer wichtiger, dass sich auch das Startup Sourcing weiterentwickelt, damit das Sourcing nicht zum Bottleneck wird um so stark wachsende Startups wie Lovable frühzeitig zu entdecken. So wie gen AI (u. a.) und AI Agents das Wachstum und Gründung von Startups zu beschleuningie, kann es auch helfen Sourcing zu beschleunigen.
Deal Sourcing ist nur ein Bereich für den KI-Einsatz im Venture Capital.
Traditionelle Arbeitsweisen und ihre Limitationen
Venture-Capital-Firmen greifen traditionell auf Datenbanken wie Crunchbase oder PitchBook sowie persönliche Netzwerke zurück. Doch dieser Ansatz stößt angesichts wachsender Komplexität auf gleich drei zentrale Herausforderungen:
1. Begrenzte Datenbanken
Klassische Plattformen liefern meist veraltete, lückenhafte oder sehr standardisierte Informationen. Gerade neu gegründete, innovative Startups mit speziellen Geschäftsmodellen oder tiefgreifender Nischenexpertise werden oft gar nicht oder erst sehr spät erfasst. Relevante Entwicklungen – wie Teamwechsel, neue Märkte oder technologische Durchbrüche – erscheinen mit Verzögerung oder werden gar nicht abgebildet. Unstrukturierte Daten aus Blogs, Social Media oder Community-Quellen bleiben meist komplett außen vor. Für immer individuellere Suchprofile reichen diese starren Daten-Grundlagen längst nicht mehr aus.
2. Fehlende Automatisierung und Intelligenz
Die meisten Tools bieten nur einfache Filter und statische Listen. Wirklich intelligente Unterstützung fehlt – etwa KI-basierte Empfehlungen, automatische Erkennung vielversprechender Startups, oder automatisierte Due-Diligence-Briefs mit Echtzeit-Risikoanalysen. Der Abgleich individueller Investmentthesen, die Erkennung von Lookalike-Targets oder dynamisches Scoring erfolgen weiterhin manuell und binden enorm viele Ressourcen. Feedback-Schleifen und kontinuierliches Lernen aus Investorentscheidungen sind nicht integriert, sodass das System nie „smarter“ wird.
3. Kein zentrales Data Warehouse (DWH)
Sobald Informationen aus mehreren Quellen genutzt werden, entsteht ein Flickenteppich aus Excel-Listen, eigenen Datenbanken und verschiedenen Tools. Ohne ein zentrales DWH fehlt die Grundlage, um alle Daten an einem Ort effizient zu speichern, flexibel abzurufen und umfassend zu analysieren. Das erschwert nicht nur das Sourcing und Portfolio-Tracking, sondern macht auch tiefere Analysen, Trend-Reports, individuelle Auswertungen und transparente Berichterstattung gegenüber Partnern und LPs unnötig kompliziert.
Für Venture-Capital-Teams wird dies vor allem dann zum Problem, wenn nach Startups gesucht wird, die bestimmten Investitionsthesen, individuellen Suchprofilen oder dem „Lookalike“-Prinzip – also der Ähnlichkeit zu bisherigen Erfolgsfällen – entsprechen sollen. Der notwendige Kontext, etwa Innovationsgrad, Marktverhalten, Teamdynamik oder strategische Positionierung, lässt sich über klassische Filter- und Listenfunktionen kaum abbilden oder miteinander verknüpfen. So bleiben viele der tatsächlich erfolgskritischen Such- und Auswahldimensionen außerhalb des Sichtfelds traditioneller Tools.
| Plattform | Funktion | Besonderheiten |
|---|---|---|
| Grata | Automatisierung von Deal Sourcing und Due Diligence | Analysiert Millionen von Unternehmen. |
| Cyndx | Datenanalytische Einblicke zur Identifikation geeigneter Investitionsmöglichkeiten | Bietet gezielte Datenanalysen zur Unterstützung. |
| SignalRank | Überwachung des Start-up-Ökosystems | Informiert über potenzielle Übereinstimmungen. |
| Crunchbase | Bereitstellung von Unternehmensdaten und Investitionshistorien | Erleichtert die Suche durch umfangreiche Daten. |
| PitchBook | Umfassende Daten zu M&A, Private Equity und Venture Capital Transaktionen | Bietet detaillierte Analysen und Berichte. |
| CB Insights | Nutzung von KI zur Analyse von Markttrends | Identifiziert Innovatoren im Markt. |
| Dealroom | Hilfe für Investoren, Startups und Scale-ups zu finden | Fokussiert auf die Identifizierung wachstumsstarker Unternehmen. |
| Tracxn | Einblicke in verschiedene Branchen zur Erkennung von Trends | Hilft Investoren bei der Analyse diverser Marktbereiche. |
Make vs. Buy
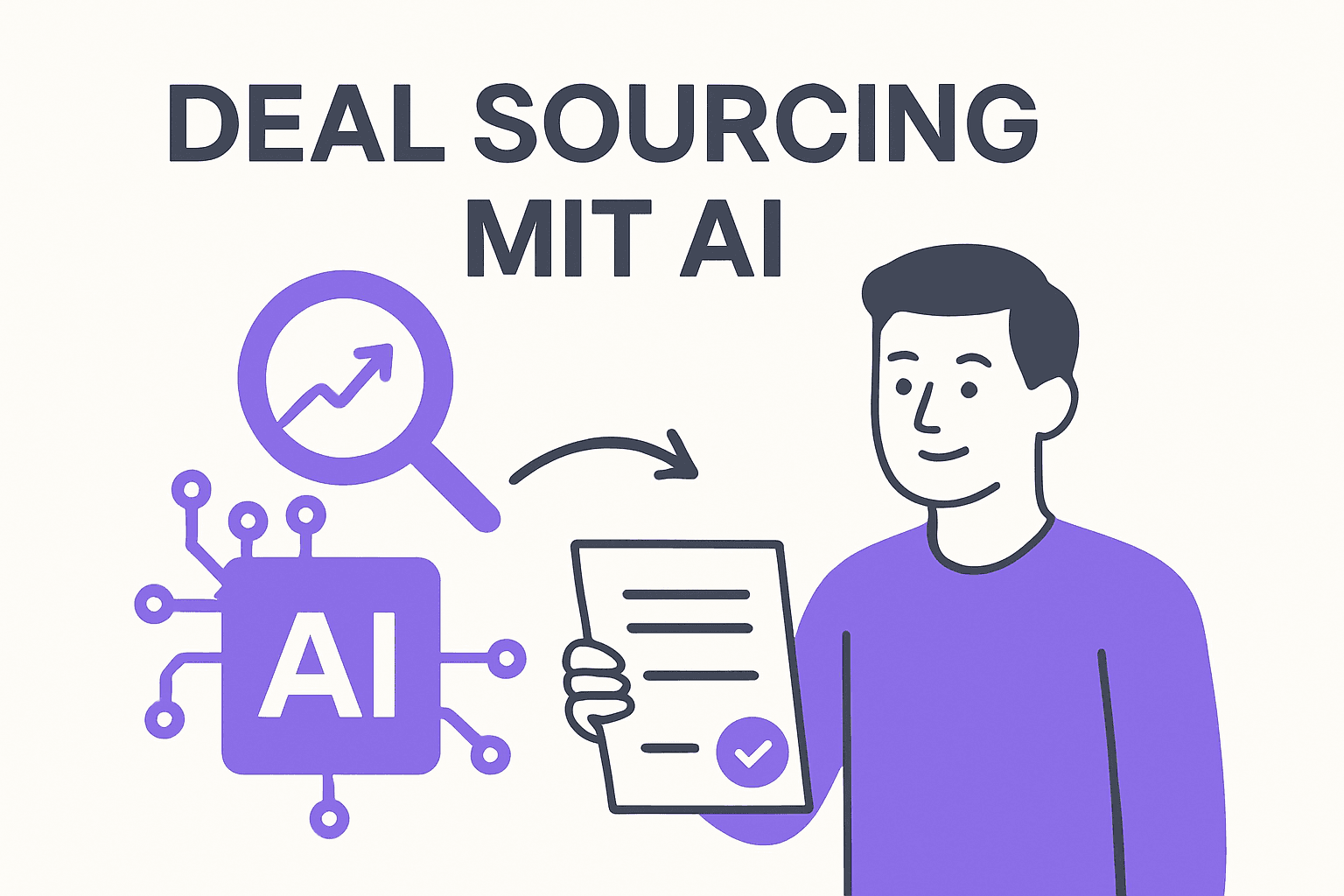
Da traditionelle Datenbanken oft lückenhaft und zu langsam sind, versuchen viele Investoren, mit eigenen Web-Scrapern aktuelleres und breiteres Startup-Wissen zu gewinnen. Eigene Scraper ermöglichen individuelle Quellenwahl, Fokussierung auf relevante Signale und Echtzeit-Updates – und damit einen Wettbewerbsvorteil beim frühzeitigen Sourcing.
Doch die Entwicklung und Wartung eigener Scraper ist technisch anspruchsvoll und aufwändig: Webseiten ändern sich ständig, Daten liegen in unterschiedlichen Formaten vor und sind oft hinter Logins oder Captchas geschützt. Dies macht kontinuierliche Anpassungen notwendig und erfordert Ressourcen und technisches Know-how, das die meisten VC-Teams nicht bereitstellen können. Für eine nachhaltige, skalierbare Lösung sind verschiedene technische Bausteine nötig, wie Quellen-Management, stabile Scraper-Tools, Daten-Aufbereitung und Qualitätskontrolle, Entity Resolution, Automatisierung, moderne Speicher- und Suchsysteme, ML-basierte Signalerkennung sowie benutzerfreundliche Dashboards und APIs.
Aus Make-or-Buy-Sicht lohnt sich der Eigenbau aber selten:
Der Aufwand für Entwicklung und dauerhafte Wartung steht zudem in keinem Verhältnis, weil sich VCs dadurch nicht auf Ihre Kernkompetenz konzentrieren können.
Unsere Lösung
Unsere Lösung basiert auf langjähriger Erfahrung mit allen entscheidenden Bausteinen für effektives Sourcing und Datenaggregation. Wir haben Kerntechnologien wie Web Scraping, Datenextraktion, Parsing und Normalisierung zu robusten, wiederverwendbaren Tools weiterentwickelt – und machen diese Power, die sonst nur große Datenplattformen wie Crunchbase im Backend nutzen, jetzt für Investoren direkt zugänglich. Was einst exklusive Backoffice-Technologie war, rücken wir in den Mittelpunkt des VC-Alltags.
Mit unserer Lösung kann jeder VC seine eigene, maßgeschneiderte "Crunchbase" aufbauen – programmiersprachenfrei und genau auf die individuellen Sourcing-Bedürfnisse zugeschnitten. Nutzer definieren relevante Quellen, Zielkriterien, Signale und Filter selbst. Dadurch entsteht eine hochspezialisierte, proprietäre Dealflow-Plattform, die perfekt zur eigenen Investmentstrategie passt. So demokratisieren wir fortschrittliche Sourcing-Technologie, die bisher nur Großanbietern vorbehalten war, und ermöglichen jedem Investor einen personalisierten, automatisierten Suchprozess – ganz ohne IT-Aufwand.
Über den direkten Zugriff auf Veröffentlichungen wie das Firmenbuch können tagesaktuelle Informationen zu Neugründungen, Gesellschafter- oder Managementwechseln erfasst werden. Partnerschaften mit spezialisierten Anbietern wie startupdetector ermöglichen es zudem, Startups unmittelbar bei ihrer Registrierung zu erkennen – noch bevor sie auf klassischen Plattformen erscheinen. Das Resultat: Sourcing-Prozesse bleiben stets aktuell, datenbasiert und branchenspezifisch justierbar.
Mittels Künstlicher Intelligenz lässt sich die Analyse heterogener Datenströme deutlich erweitern. Moderne KI kann nicht nur klassische Datenbanken, sondern auch Patentdaten, Branchennachrichten, Firmenbücher und Social-Media-Trends auswerten. Dadurch werden auch solche Unternehmen identifiziert, die sich (noch) unterhalb des Radars der Öffentlichkeit bewegen.
Kernstück dieses datengetriebenen Vorgehens ist der Kontextgraph: Unterschiedliche Informationsquellen werden in einer dynamisch vernetzten Struktur zusammengeführt – in Echtzeit und zunehmend autonom. So entstehen Entscheidungsgrundlagen, die verschiedene Perspektiven integriert abbilden, Prozesse beschleunigen und die Präzision der Auswahl deutlich erhöhen.
Unser Ansatz vereint die Flexibilität individueller Scraper-Lösungen mit dem Komfort fertiger SaaS-Tools. Sie bestimmen, welche Daten und Quellen für Sie relevant sind – wir übernehmen Technik, Wartung und Weiterentwicklung. Heraus kommt eine Plug-and-Play-Plattform, die stets aktuell, skalierbar und leicht zu bedienen ist – mit passgenauen, individuellen Ergebnissen.
Ein zentraler Bestandteil: Unser integriertes Data Warehouse (DWH). Damit können Investoren sämtliche Daten standortübergreifend speichern, organisieren, verknüpfen und flexibel auswerten – egal ob für Sourcing, Portfolio-Analysen, individuelle Auswertungen, Mustererkennung oder umfassendes Reporting für Partner und LPs. Das DWH macht alle Analysen, Reportings und fundierte Entscheidungen einfach und effizient möglich.
Kurzum: Unsere Lösung vereint Daten aus allen wichtigen Startup-Datenbanken (z.B. Crunchbase, Dealroom), kombiniert sie mit eigenen Web-Crawlern und Ihrem internen Wissen – alles in einer zentralen Plattform. So erhalten Sie den umfassendsten, individuellsten und praxisrelevantesten Blick auf das Startup-Ökosystem – an einem Ort.
Evidenzbasiertes Sourcing: Der strukturierte Multi-Stufen-Prozess
Schrittweise Vorgehensweise:
- Datenaggregation: Echtzeit-Erfassung von Quellen wie Startup-Datenbanken, Firmenbüchern, Webseiten, Commerce-Plattformen (z. B. Shopify, WooCommerce), Branchennachrichten.
- Themen- und Attributfilterung: Startups werden anhand von Investmentthesen oder branchenspezifischen Kriterien gefiltert und bewertet. Beispiel: Die Identifikation von „200 Early-Stage-E-Commerce-Startups auf Shopify oder WooCommerce inklusive Founder-Kontaktdaten und Produktkategorie“.
- Kontextuelle Signalerkennung: Mittels NLP und Mustererkennung werden Themen wie Teamwechsel, Produkt-Neustarts, Markteintritte oder Technologiemeilensteine extrahiert.
- Automatisierte Priorisierung: KI-basierte Scoring- und Empfehlungssysteme spiegeln sowohl marktübliche Benchmarks als auch unternehmensspezifische Strategien wider.
- Beschleunigte Due Diligence: Automatisierte Research-Briefs, Risikoflaggen und historische Benchmarks optimieren die Auswertung.
- Lernende Systeme: Zahlreiche Feedback-Loops und Interaktionen führen zu kontinuierlichen Verbesserungen in der Relevanz und Qualität der Vorschläge.
Besonders wichtig: Die Einbindung individueller Bewertungskriterien. Wo früher auf Black-Box-Modelle externer Anbieter zurückgegriffen werden musste, können jetzt unternehmenseigene Hypothesen, Risikomodelle und Gewichtungen direkt integriert werden – und bleiben so flexibel anpassbar. So entsteht maximale Transparenz und Nachvollziehbarkeit.
Auch zur Erkennung künftiger Finanzierungsrunden können KI-Modelle beitragen – etwa auf Basis von Patentanmeldungen, PR-Aktivitäten oder gezieltem Recruiting. Dennoch bleiben dies Wahrscheinlichkeitsmuster, die menschliches Urteilsvermögen sinnvoll ergänzen, aber nicht ersetzen.
Vorteile auf einen Blick
Ein systematischer, KI-gestützter Ansatz bietet messbare Mehrwerte:
- Hyper-spezifische Suchanfragen erstellen
- Die berühmte „Nadel im Heuhaufen“ finden – relevante Startups identifizieren, selbst in Nischensegmenten
- Neue, vielversprechende Unternehmen identifizieren
- Schnell wachsende Firmen entdecken
- Repetitive Recherchearbeit automatisieren
- Tiefgehende, mehrdimensionale Profile nutzen
- Mit Branchen-Benchmarks vergleichen
- Veränderungen in Wertschöpfungsketten / Ökosystemen verfolgen
- Innovation und Disruption frühzeitig erkennen
- Für Outreach präzise flexibel segmentieren
- Teamübergreifend kollaborieren und teilen
- Targeting per Feedback laufend verbessern
- Trends und Chancen visuell analysieren
